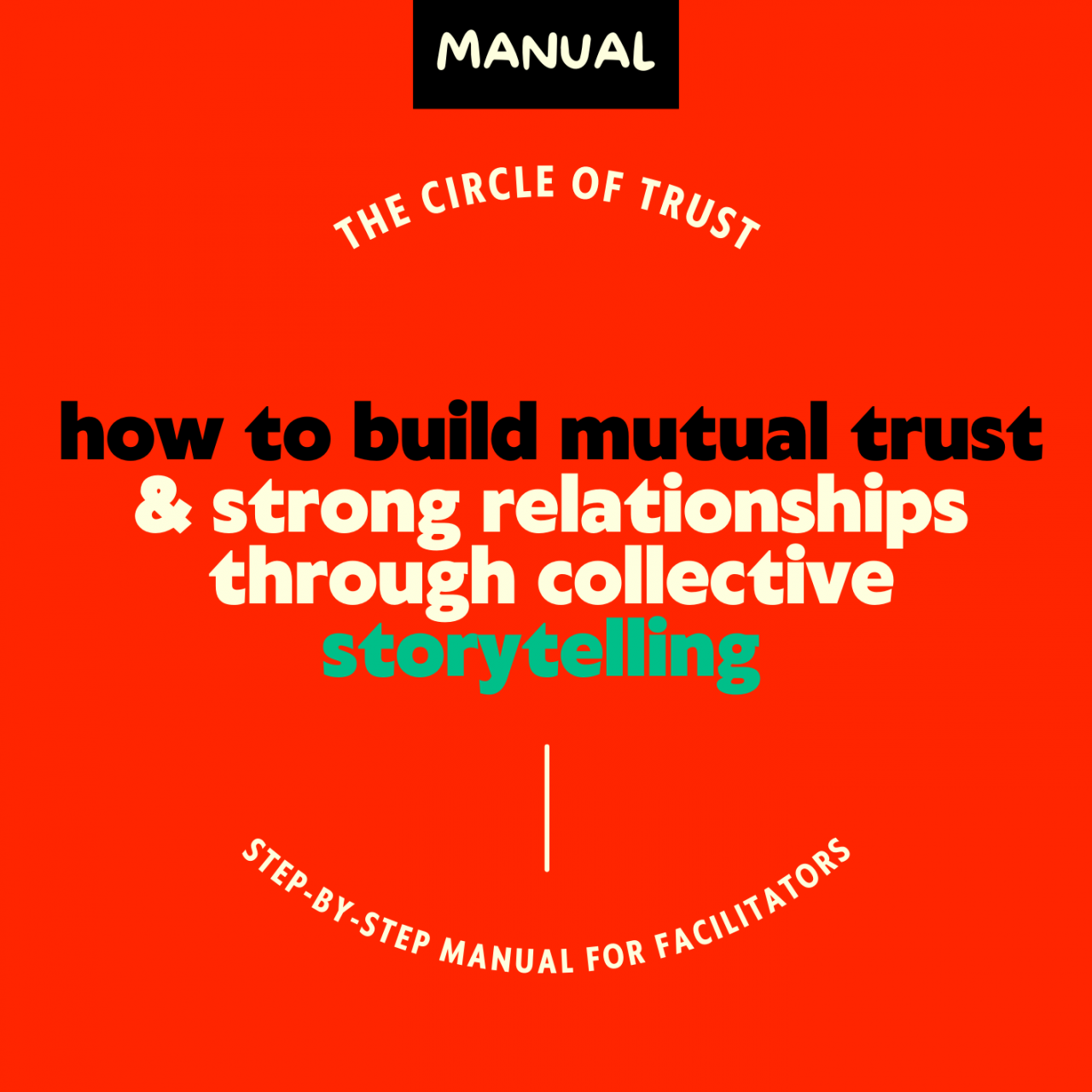Interview mit Hannah Zimmermann zur Ausstellung “Offener Prozess” im Rahmen der Reihe “Einfach gut gemacht” von John-Dewey-Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie (Quelle: JoDDiD Forschungsstelle)
“Vom Lernen und Verlernen” – Methodenhandbuch zur rassismuskritischen Aufarbeitung des NSU-Komplex (Autorinnen: Hannah Zimmermann in Zusammenarbeit mit Martina Klaus)
Aus dieser Arbeit ist dann “re:member the future” entstanden, weil dieser Ort ein lebendiges Gedenken und Erinnern an die Opfer und für die Betroffenen ermöglichen soll, das über eine Ausstellung hinausgeht. Dafür erstellen wir gerade ein Konzept, führen Gespräche mit Hinterbliebenen und Angehörigen der Anschläge und versuchen herauszufinden, wie ein solcher sozialer Erinnerungsort für sie aussehen sollte. Und irgendwann muss dieses Konzept dann von der Chemnitzer Stadtpolitik auch umgesetzt werden …
Wie arbeitet Ihr in diesen Gesprächen und wie seid Ihr mit den Betroffenen in Kontakt gekommen?
Mit meinen Kolleg:innen haben wir schlichtweg zuerst einen Brief verfasst, um das Projekt und die Idee den Angehörigen vorzustellen und sie zu fragen, ob sie zu einem Gespräch bereit wären. Die Reaktionen darauf waren natürlich sehr gemischt, weil das Thema für viele sehr belastend ist. Einige haben sich deshalb auch aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, andere stehen für Gespräche bereit. Einige – viele Kinder der Hinterbliebenen – gehen wiederum aktiv in die Öffentlichkeit und leisten großartige, politisch engagierte Bildungsarbeit.
Im Zuge des NSU-Komplexes und infolge neuer rassistischer Anschläge bilden sich aber auch immer mehr Netzwerke in Deutschland, um die antirassistischen Kämpfe zu bündeln. Einige dieser Initiativen und Gruppen haben wir besucht und mit anderen haben wir online gesprochen. Und da haben wir Interviews geführt, um zu fragen, was sie sich vorstellen, was sie gerne möchten und was sie nicht möchten, und ob sie überhaupt daran interessiert sind. Es ist wichtig, die Anliegen und Wünsche möglichst breit zu verstehen, da antirassistische Kämpfe und migrantische Selbstorganisierung ja nicht erst gestern begonnen haben.
Was sind denn die Wünsche und Forderungen, die Euch jetzt in diesem Prozess begegnet sind?
Sie sind einerseits sehr divers und heterogen, aber alle vereint die Betonung der Notwendigkeit von politischer Bildungsarbeit, dass natürlich die Opfer und der NSU-Komplex nicht vergessen und junge Menschen dafür sensibilisiert werden können. Einerseits ist der NSU-Komplex nach wie vor nicht vollständig aufgeklärt und andererseits haben viele junge Menschen die Taten nicht mehr im Gedächtnis.
Auch die jüngeren Anschläge in Hanau und Halle zeigen eine Kontinuität rechter Gewalt in Deutschland. Um dieser Kontinuität und der fortlaufenden Notwendigkeit des Erinnerns gerecht zu werden, sollte der Erinnerungsort dynamisch und interaktiv sein, und nicht einfach nur da stehen. Und deshalb heißt es auch “re:member the future”, weil das Erinnern immer auch das Verändern beinhaltet und in eine Zukunft getragen werden muss, damit sich die Ereignisse und die Traumata nicht wiederholen.
Wie reagieren denn Schüler:innen und junge Menschen eigentlich auf Eure Wanderausstellung “Offener Prozess”?
Es kommt einerseits darauf an, ob sie selbst von Rassismus oder Diskriminierung betroffen sind oder nicht. Wir haben das Gefühl, dass das Thema für einige immer schwerer greifbar wird. Die Ausstellungswerke laden deshalb dazu ein, sich nicht nur auf die einzelnen Taten zu fokussieren, sondern auch auf migrantische Erzählungen und Perspektiven von Betroffenen. Das löst bei vielen tiefe emotionale Reaktionen aus. Einige stellen Bezüge zu ihren eigenen Diskriminierungserfahrungen her, weil sie die Ausstellung als einen “safer space” erleben.
Andererseits ist aber auch wichtig, dass der NSU-Komplex nicht nur Personen betrifft, die Rassismus erleben, sondern auch eine große Rolle in Bezug auf Antisemitismus und die Diskriminierung von Sinti:zze und Rom:nja, aber auch bei Gewalt gegen Linke und queere Menschen spielt. Es handelt sich um eine menschenverachtende Ideologie, die viele Menschen betrifft, und nur weil man von Rassismus betroffen ist, bedeutet das nicht notgedrungen, dass man nicht anderweitig selbst Teil von rassistischen und diskriminierenden Strukturen sein kann.
Und wenn sie gemeinsam die Ausstellungswerke betrachten, haben sie die Möglichkeit, das Gesehene und ihre eigenen vielschichtigen Erfahrungen aufzuarbeiten. Das ist ein wichtiger Faktor, denn viele können sich darin wiedererkennen, andere nicht, aber es bietet den Raum, um zusammenzukommen und darüber zu sprechen.
Insbesondere in der politischen Bildungsarbeit mit Jugendlichen erscheint mir der Mangel an Gefühlsarbeit immer wieder eklatant. Wo gibt es diese Räume, in denen diese politische Gefühlsarbeit ermöglicht wird und Ambiguitäten und Widersprüche ausgehalten und ausgehandelt werden können.
Dieses Wiedererkennen in den Geschichten kann ja sehr doppeldeutig sein. Einerseits bedeutet es, dass man sich als potenzielles Opfer identifiziert, andererseits erfährt man, dass man überhaupt gesehen und in der eigenen Erfahrung anerkannt wird. In der "almanisierten" politischen Bildungsarbeit gibt es manchmal eine Tendenz zur Emotionslosigkeit und reinen Beschränkungen auf Daten, Fakten und Argumente. Was glaubst Du, was junge Menschen mit Rassismuserfahrung und Migrationsgeschichte eigentlich bewegt?
Wenn Gleichaltrige ihre eigenen Geschichten erzählen, wie es zum Beispiel ist, als Kind von Vertragsarbeitenden in Ostsachsen aufzuwachsen, schafft das eine besondere Nähe und Intimität. Und es geht auch darum, Identität zu verhandeln – Fragen wie "Wo komme ich her?", "Wo kommen meine Eltern her?", "Wo wachse ich auf?" kommen dann auf. Während die ankommenden Generationen, also die Vertragsarbeiter:innen in der DDR und die Gastarbeiter:innen in der BRD, eher damit beschäftigt waren, hier anzukommen, haben die jüngeren Generationen mehr Kraft oder mehr Möglichkeiten, sich auch dem Rassismus entgegenzustellen. Da geht es viel um Identitätspolitik, aber Identität ist keine starre Angelegenheit. Sie fließt ständig und verändert sich immer wieder, weshalb sie auch immer wieder verhandelt werden will.
Dies zeigt sich auch in der Ausstellung, wo eine Arbeit von Želimir Žilnik aus den siebziger Jahren Vertragsarbeiter:innen zeigt, die im Treppenhaus in München erzählen, wie ihre Lebensrealität aussieht. Im Jahr 2021 haben wir als Projekt gemeinsam mit der Künstlerin Pınar Öğrenci diese Thematik in Chemnitz aufgegriffen, wo ich mitgespielt habe, um zu sehen, wie es heute bei migrantischen Personen in Deutschland aussieht. Es ist interessant, solche vergleichende Perspektiven zu sehen.
Bilder von Wanderausstellung “Offener Prozess. NSU-Aufarbeitung in Sachsen” in der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig (Fotos: Alexandra Ivanciu)
Ich muss daran denken, dass ich es immer wieder als bedrückend empfunden habe, wenn Gastarbeiter:innen der ersten Generation nach ihren Rassismuserfahrungen gefragt wurden und die Antwort häufig lautete: "Nein, Rassismus habe ich nicht so schlimm erlebt." Wenn man dann aber genauer nachfragt und konkrete Alltagssituationen anspricht, zum Beispiel am Arbeitsplatz, dann wurden sehr wohl krasse Ungerechtigkeiten benannt, dass sie mehr arbeiten mussten, dass sie schlechter bezahlt wurden, und all die anderen Demütigungen des Alltags …
Ich frage mich, was für ein politisches Selbstbewusstsein oder auch Empowerment erzeugen solche Projekte, wie ihr sie macht, dass die jüngere Generation plötzlich benennen kann, dass es Rassismus gibt. Dass das nicht nur einen Namen bekommt, sondern aus einer erfahrenen auch eine aussprechbare Realität wird.
Ich selbst habe zwar auch eine Migrationsbiografie, aber bin nicht in Deutschland geboren und habe selbst auch keinen Vertragsarbeitenden- oder Gastarbeitenden-Hintergrund. Ich glaube, was auch durch die Ausstellung sehr deutlich wird, ist, dass in einem unserer Ausstellungsstücke “Sorge 87” von Thanh Nguyen Phuong, sie selbst als Kind von Vertragsarbeiter:innen mit ihren Eltern ins Gespräch kommt. Ich denke, das ist der erste Schritt, um überhaupt anzufangen, darüber zu sprechen, wie es damals war. Durch die Erzählungen wird rückwirkend vieles anders sichtbar, als im Moment des Ankommens. Damals hatte man auch einfach ganz andere Sorgen, wie das Erlernen der Sprache, die Suche nach Arbeit, und die rechtliche Lage sah damals auch anders aus. Vieles hat sich zum Glück verändert, aber vieles auch nicht.
Der gesellschaftspolitische Diskurs darüber hat sich aber erheblich verändert. Junge Menschen sind heute viel sensibler für Rassismus. Man weiß darüber mehr, man spricht darüber auch vermehrt in der Schule. Das befördert alles einen wichtigen gesamtgesellschaftlichen Prozess, um Fragen zu stellen, sich auszutauschen und auch den Eltern zuzuhören, ihre Erfahrungen zu verstehen und sich trotz der unterschiedlichen Perspektiven auf diese Geschichten zu “versöhnen” – selbst wenn das Sprechen darüber auch in den Familien erst gelernt werden muss.
Das kann dann häufig ein schmerzhafter Prozess der innerfamiliären Auseinandersetzung der Generationen sein, zwischen Kindern, die vielleicht die Universität absolviert haben und die Traumata ihrer Familiengeschichte aufarbeiten wollen, und Eltern, die sich umgekehrt vielleicht nicht mehr mit den Demütigungen der Vergangenheit befassen möchten. Wie kann da ein Gespräch entstehen?
Ich glaube, dass oft erst einmal Frust und Wut entstehen, besonders bei jenen, deren Eltern Rassismus nicht offensichtlich wahrnehmen oder benennen können. Das ist natürlich für die Kinder oft unverständlich, weil sie rassistische Erfahrungen auch gegenüber ihren Eltern erfahren haben. Ich finde jedoch, dass wir der älteren Generation ihre Perspektive lassen müssen. Es ist schwierig, unseren eigenen Diskurs und unsere Sichtweisen heute einfach über ihre Erfahrungen zu stülpen. Wir müssen ihnen ihre Erfahrung und den Umgang damit einfach zugestehen.
Ich würde jedoch eher den Fokus nach außen verlagern oder zumindest den Konflikt. Wir sollten Räume schaffen, in denen zukünftig Geschichten archiviert werden, damit diejenigen, die sprechen möchten, aber auch andere, die es nicht möchten, Zugang zu diesen narrativen und emotionalen Ressourcen bekommen. Es geht dabei schließlich um unser kollektives Wissen, um das “Retelling”, das Neu-, Wieder- und Umerzählen von Geschichten, wer sie wie, wann, wo und warum erzählen kann und wie wir letztlich Geschichte in unserem Sinne neu schreiben können. Vor allem auch hier in Ostdeutschland, wo Geschichte für viele Menschen nicht erzählbar ist.